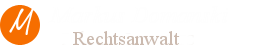Nach einem Fehler des Rechtspflegers bei der Zwangsvollstreckung kämpft eine Familie seit 2014 um ihre ersteigerte Immobilie. Das mag verwundern, denn der Erwerb in einer Zwangsvollstreckung ist Erwerb kraft Gesetzes und damit eigentlich rechtsbeständig, wenn es nicht eine winzige Einschränkung gäbe. § 90 Abs. 1 ZVG lautet:
Durch den Zuschlag wird der Ersteher Eigentümer des Grundstücks, sofern nicht im Beschwerdewege der Beschluß rechtskräftig aufgehoben wird.
Leider wurde dieser Beschluss im Beschwerdewege aufgehoben, und damit hätte die Familie eigentlich Pech gehabt und müsste sich ihren Schaden im Wege der Amtshaftung ersetzen lassen. Das wäre natürlich teuer, für den Staat. Vielleicht auch deshalb hat der BGH nun in seiner unendlichen Weisheit eine „salomonische Lösung“ gefunden: Der ursprüngliche Eigentümer bleibt Eigentümer, er muss jedoch, sofern er weiterhin Grundbuchberechtigung und Herausgabe verlangt, Verwendungsersatz an die Familie leisten, die insoweit ein Zurückbehaltungsrecht hat. Nebenbei hat der BGH auch noch seine ständige Rechtsprechung zum sog. „engen Verwendungsbegriff“ aufgegeben. Damit ist im Ergebnis der ursprüngliche Eigentümer auf die Amtshaftung angewiesen, wo seine Chancen wegen § 839 Abs. 1 S. 2 BGB deutlich schlechter stehen, weil er möglicherweise einen Schadensersatzanspruch gegen seinen damaligen Anwalt hat – Hemmung der Verjährung außen vor. Das LG Potsdam führte dazu im Jahre 2014 folgendes aus:
„Auch der benannte Zustellungsvertreter, Rechtsanwalt Ch. S., dürfte seinen Verpflichtungen nicht nachgekommen sein. § 7 Abs. 2 Satz 1 ZVG bestimmt, dass der Zustellungsvertreter zur Ermittlung und Benachrichtigung des Vertretenen verpflichtet ist. Dies ist auch in dem Beschluss vom 19. Januar 2009 so wiedergegeben. Anhaltspunkte dafür, dass der Zustellungsvertreter überhaupt Tätigkeiten zur Ermittlung des Aufenthaltes oder einer Zustelladresse des Schuldners entfaltet hat, lassen sich jedenfalls aus der Gerichtsakte nicht entnehmen. Er hat offensichtlich noch nicht einmal die Gerichtsakten eingesehen. Hätte er dies getan, dann wäre ihm anhand der Unterlage Blatt 32 d.A. sogleich aufgefallen, dass sich die Möglichkeit der Ermittelung des Aufenthaltsortes über die dem Finanzamt bekannte Anschrift aufdrängte.“